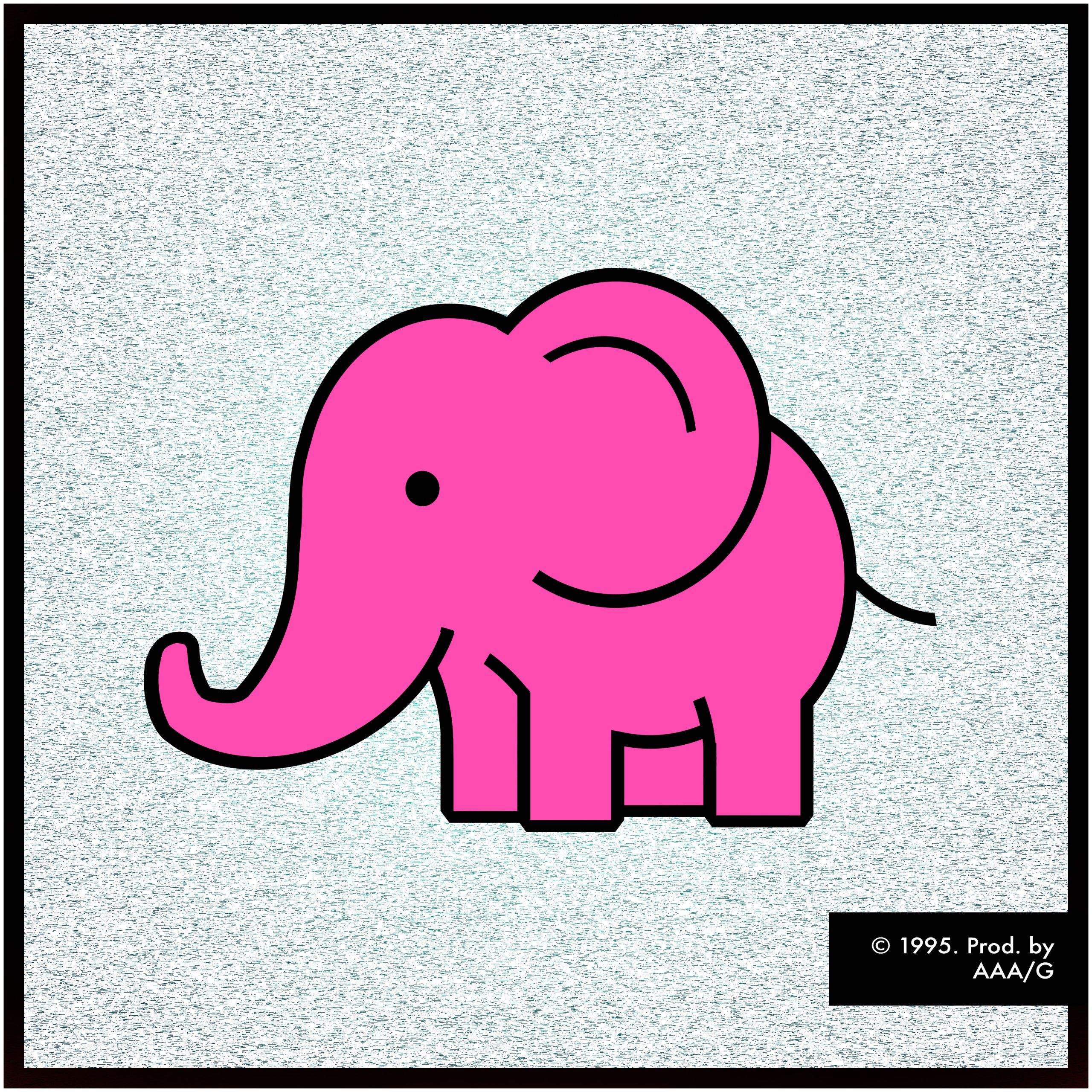Denk nicht an einen Rosa Elefanten…
Das erste Mal Gras konsumierte ich auf der Studienfahrt gemeinsam mit meinen Schulfreunden in der Oberstufe. Statt langweiliger Altstadt und Museen, erlebten wir Sonnenschein und eine leichte Brise auf einem Segelboot im IJsselmeer. Wir bräunten uns auf Deck während wir Musik hörten, uns unterhielten, oder verträumt in die Wolken sahen – zwischendrin ankerten wir und gingen Baden, und machten Abends an den kleinen verschlafenen holländischen Dörfern fest, um auf Erkundungstour zu gehen.
So eine richtige Wirkung (abgesehen von meinen roten Augen) spürte ich damals noch nicht. Ich wusste allerdings auch nicht wie es wirken sollte. Spitzname „Non-responder“.
Den nächsten richtigen Berührungspunkt mit Cannabis hatte ich dann in Frankfurt. Freunde von mir waren mit Drogen durchaus schon erfahrener, so gab es vereinzelte Situationen, in denen ich auch mal einen Joint mitrauchte – die Droge der Wahl blieb jedoch Alkohol. Vollsuff am Wochenende und „ein bis zwei Feierabendbier“ unter der Woche.
Richtig Fahrt nahm das Thema Cannabis-Konsum für mich erst auf, als ein paar Dinge zusammenkamen. Unser Freundeskreis erweiterte sich um den Bruder meines ehemaligen Mitbewohners und ein paar von deren alten Schulfreunden. Plötzlich ergab sich der zufällige Kontakt zu einem der besten Ansprechpartner für Dies und Das. Und mit der Corona-Zeit gab es auf einen Schlag auch nicht mehr viel anderes zu tun, als mit Freunden gemütlich abzuhängen.
Und mit der Entdeckung meiner Leidenschaft fürs Musik machen begann auch eine rebellische Phase. Scheiss auf konservativ – vor allem wenn parallel dazu der Job (der am Anfang noch eine große Erfüllung war) einen sowieso nur noch Mürbe macht.
Das Gras veränderte meinen Geist. Ich erlebte eine tiefe Begeisterung für das Universum, die ich (wenn ich sie je auf diese Weise gespürt habe) zuletzt in meiner Kindheit empfunden haben muss. Und mir fielen plötzlich ein paar Sachen auf, die mir komisch erschienen. Mir wurde auf dumpfe Weise bewusst, dass ich mich irgendwie in einem Hamsterrad befand. Und auch in anderen Bereichen des Lebens spürte ich, dass ich irgendwie feststeckte.
Ich versuchte, mit anderen Leuten darüber zu sprechen – doch sie konnten mein Denken nicht nachvollziehen. Fairer Weise war ich selbst noch wie gefangen hinter einem Schleier der Begeisterung und Verwirrung und konnte meine eigenen Gedanken nicht richtig zuordnen oder gar nachvollziehbar ausformulieren.
Das Gras kurbelte meine Denkprozesse und Kreativität an. Ein Teil von mir hatte das Gefühl, dass irgendwo in diesen neu entstehenden Gedankengängen eine Form von unbekannter Wahrheit zu finden sein müsste. Ich bin weniger ein Mensch für halbe Sachen – und wenn man eine Hypothese testen will und dabei noch Spaß haben kann, dann ist eine gewisse Hingabe vielleicht nicht so verkehrt.
Die Aufklärung über Cannabis in Filmen und Medien ist eher schlecht. Ich habe meinen Konsum absolut verharmlost und war mir nicht dessen bewusst, dass die Droge nicht nur positive Gefühle verstärkt, zu guter Laune, Lachflashs, und Fressattacken führen kann – sondern auch depressive Stimmungen und Paranoia verstärkt.
Aus wenig wird mehr. Und da meine berufliche Laufbahn sich immer mehr zu einer Enttäuschung und Sackgasse entwickelte, verschlechterte sich auch meine Stimmung. Ich war völlig erschöpft, fühlte mich bei all den politisch-strategischen Spielchen im Büro (und in der Welt) von bösen Absichten verfolgt, und wollte mich einfach nur aus der Situation befreien. Erst als ich keinen anderen Ausweg mehr sah, ging ich zum Arzt – wurde krank geschrieben und erhielt den Hinweis, mir lieber einen Anwalt zu suchen, als auf eine längere Auszeit zu hoffen. Ohne zur Arbeit zu müssen erholte ich mich ein wenig. Das Gespräch mit der Anwältin brachte jedoch nicht das erhoffte Ergebnis – vielmehr war es ein Aufklärungsgespräch darüber, was ein Arbeitsvertrag ist, welche Verantwortung ich in meiner Rolle wirklich hatte, und dass Kollegen und Vorgesetzte nunmal keine Freunde waren.
Ich musste also nach ein paar Wochen wieder zurück. Doch ich hatte schon gekündigt – deshalb war es glücklicherweise nur eine Rückkehr auf Zeit. Und die saß ich ab. Ich war erreichbar für Fragen und dokumentierte alles was ich verantwortet hatte, damit man mir später nicht die Schuld dafür geben konnte, dem Unternehmen mit böser Absicht geschadet zu haben. Neue Aufgaben lehnte ich ab und wurde somit nicht weiter behelligt.
Ein Abschied im Guten sieht sicherlich anders aus – aber man trennt sich schließlich auch nicht, weil alles gut läuft.
In den zwei Wochen nachdem ich komplett aus dem Job raus war, ging ich in meinem Musik-Projekt auf – und mein Cannabis-Konsum erlebte ein neues Extrem. Doch die Belastung war weiterhin hoch – kein neuer Job, der Wunsch von meiner Musik leben zu können, und ein gigantischer Haufen noch unverarbeiteter Traumata und Emotionen, die durch meine Songtexte nur so aus mir herausbrachen.
Die Katastrophe und der Zusammenbruch waren vermutlich absehbar.
Nach der Psychiatrie war für mich klar, dass weiter kiffen in der Situation das sichere Ticket zurück wäre. Ein kleines Auffangnetz und etwas Glück im Unglück bewahrten mich vor Schlimmerem… Doch jetzt musste ich erstmal wieder einen Sinn finden und mit mir selbst klären, wie der Rest meines Lebens nun aussehen sollte.
Die Rückkehr ins Leben brauchte seine Zeit. Und selbstverständlich gab es auch immer wieder Momente, in denen ich mir nur zu gerne einen Joint angezündet hätte. Ich blieb stark, weil ich wusste, dass es eine Festung bräuchte, um mich vor einer Rückkehr in die Entmündigung zu bewahren. Zur Kompensation begann ich mein Ritual mit reinem Tabak zu ersetzen. Es war zwar bei Weitem nicht dasselbe, doch es gab mir wieder ein bisschen das Gefühl, rebellisch sein zu können.
Wer zu rauchen anfängt, fängt an zu rauchen. Ich begann öfter auch mal das Angebot einer Zigarette von Freunden anzunehmen – doch im Vergleich zu Drehtabak schmecken normale Zigaretten nicht besonders gut. Und ich identifizierte mich eigentlich auch garnicht als Raucher – ich rauchte ja nur des Rituals wegen zu „besonderen“ Anlässen und vermied es tagsüber rein der Gewohnheit wegen mir eine anzustecken.
Der Gewohnheit verfiel ich trotzdem immer wieder. Ich rauchte eine Woche, lies es dann wieder bleiben, rauchte dann zwei Wochen, und so weiter – doch ich machte mir nichts draus. Was solls… irgendwann hör ich ja auch wieder auf, dann ist das im Großen und Ganzen auch keine so schädliche Sache. Zweifel bekam ich, als das Rauchen anfing ein beklommenes Gefühl in meinem Hals zu hinterlassen. Meine Stimmbänder wollte ich mir nicht kaputt machen. Ein paar mal testete ich meine Hypothese noch, um sicherzugehen, dass es mir auch wirklich schadete – doch mit jedem Mal wo sich das Rauchen noch Tage danach in meinem Hals komisch anfühlte, drehten sich meine Gedanken stärker um mögliche Konsequenzen.
Nur weil man einem Verstand einpflanzen will, dass Zigaretten-Tabak Krebs verursacht, muss man sich ja noch lange nicht davon beeinflussen lassen – wahrscheinlich ist es wie beim Placebo-Effekt sowieso mehr Kopfsache, ob man tatsächlich erkrankt… Doch ich musste mir eingestehen, dass die Gedanken bereits in meinem Kopf waren. Ich konnte also weiter meine Paranoia im Verstand bekämpfen, weitere schlechte Cannabis-Alternativen austesten, oder mit dem Drehtabak aufhören. Ich hörte auf.